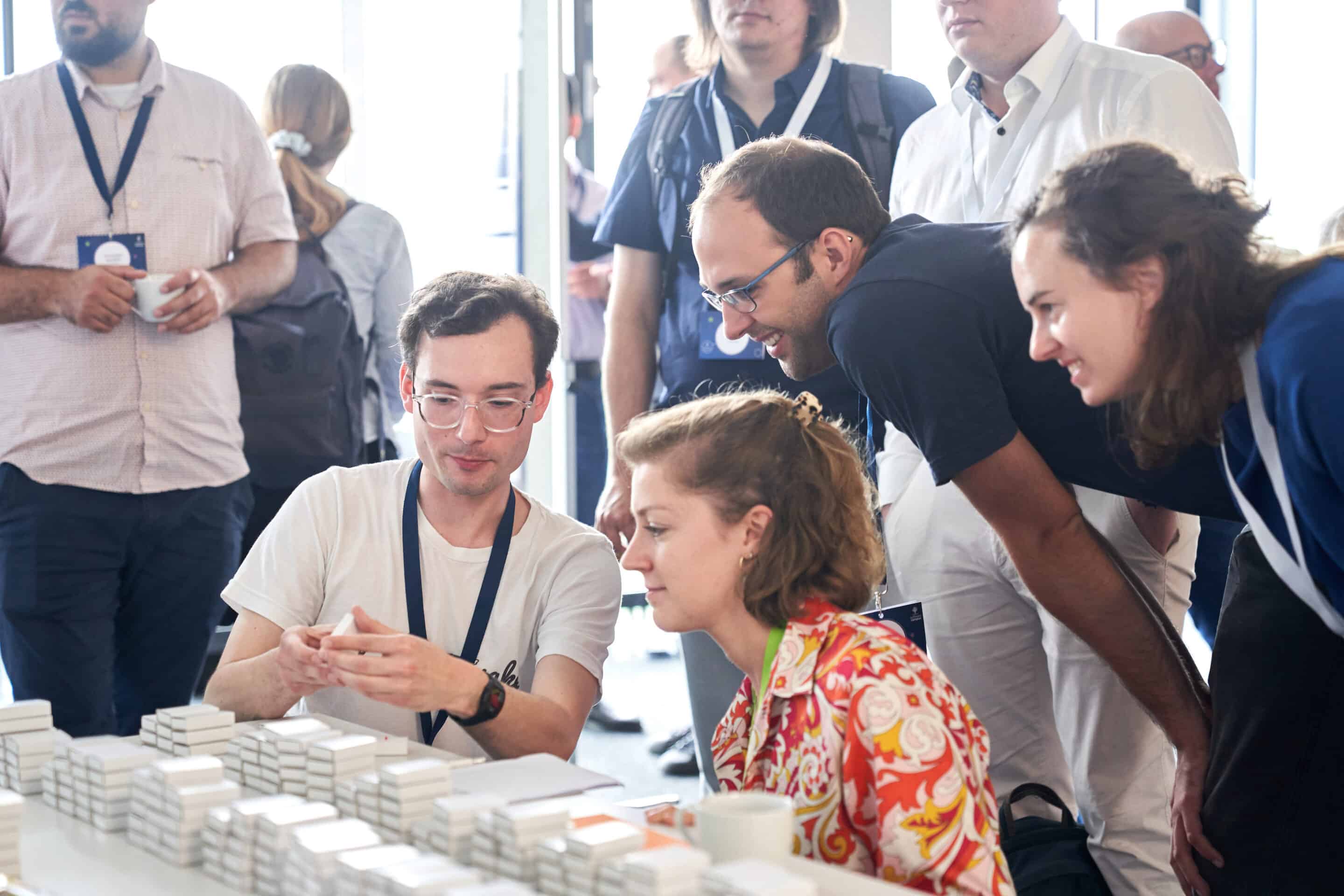Prof. Dr. Dieter Rombach, Gründer und langjähriger Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern, im Gespräch über Führung, Gründung und Innovationen. Welche Ereignisse haben sein Leben als Führungskraft beeinflusst, welche Trends sieht er 2015 und welche Stärken muss Europa als Gründungsstandort ausbauen?
Fraunhofer bildet ja auch im Software Campus die IT-Führungskräfte von morgen aus – was braucht eine gute Führungskraft aus Ihrer Sicht?
Eine gute Führungskraft braucht natürlich zum einen fachliche Kompetenz – in der heutigen Zeit kann man nicht nur mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen punkten. Sie braucht darüber hinaus auch Verständnis für die Probleme der Praxis – Menschenführung, Teamführung. All das ist es, was unsere Teilnehmer in ihren Promotionen mit dem Software Campus mitbekommen.
Gibt es ein einschneidendes Erlebnis in Ihrer Karriere, das Sie besonders geprägt hat? Welches war das?
Ja, nach meiner Promotion ging ich in die USA und habe dort eine Projektleitungsstelle bei der NASA angenommen. In meiner ersten Präsentation habe ich alles, was ich wusste „reingepackt“, und der Chef hat mich gefragt: „Na und?“. Er hat mich wirklich zum Staunen gebracht.
Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich auf die Zielgruppe einzustellen. Ich glaube, das ist es auch, was unsere StudentInnen ganz häufig an der Universität nicht lernen: sich darauf einzustellen, wie dieselbe inhaltliche Präsentation – vor Industrie, Wissenschaft oder anderen Gruppen gehalten – aussehen muss. Man kann viele Probleme vermeiden, wenn man sich vorher ein paar Minuten damit beschäftigt und hinterfragt, wo eigentlich beim Zuhörer „der Schuh drückt“, wo sie Probleme haben – und darauf dann seine Präsentation und Arbeit entsprechend zu fokussieren. Auch dazu trägt der Software Campus und die frühe Beziehung zu Firmen bei. Das ist etwas, was die TeilnehmerInnen aus meiner Sicht in unglaublich guter Form lernen.
Was raten Sie jungen Forschern von Fraunhofer für deren Karriere?
Bei Fraunhofer haben sie verschiedene Karrieremöglichkeiten. Wir haben MitarbeiterInnen, die in die Hochschullandschaft gehen und ProfessorInnen werden. Wir haben MitarbeiterInnen, die durchaus langfristig im Fraunhofer-Netzwerk bleiben und solche, die in die Wirtschaft gehen. Deswegen bilden wir diese nicht nur fachlich aus. Der Spagat ist fachlich exzellent zu sein, aber auch die Soft Skills mitzulernen.
Und je nachdem, je früher mir jemand sagt, in welche Richtung er oder sie gehen will, umso mehr können wir dann natürlich auch die Projektarbeit auf die Bedürfnisse zur Unterstützung der Karriere ausrichten.
Innovation made in Germany: Was war die Innovation, die Sie 2014 besonders beeindruckt hat?
Es war zwar nicht 2014, aber als Fraunhofer-Mann muss ich natürlich mp3 nennen. Allerdings glaube ich auch, dass Innovationen heute nicht mehr in einzelnen Disziplinen, sondern interdisziplinär entstehen. Alles, was wir heute „Digitalisierung der Wirtschaft“ nennen, ist interdisziplinär. Und wir, sowohl wir in unserem Forschungsgebiet bei Fraunhofer als auch EIT ICT Labs, führen ja genau diese interdisziplinäre Forschung durch, um damit in allen Branchen Innovationen zu ermöglichen. Ich glaube durchaus, dass solche Dinge wie Uber zum Beispiel, die in der Diskussion sind, kleine Snapshots von dem sind, was in Zukunft an Geschäftsmodellen entstehen wird.
Welche IT-Trends werden 2015 aus Ihrer Sicht die IT-Branche aufrütteln?
Eine der Herausforderungen, die ich sehe, ist tatsächlich Big Data effektiv zu nutzen, um die Networking-Intelligenz in Systemen zu implementieren, aber gleichzeitig Vertrauen zu schaffen. Wir haben gerade in Umfragen gelesen, dass über 50% der Mittelständler die Cloud nicht nutzen, weil sie ihr nicht trauen. Darin liegen aber Zukunftsinnovationen. Wir müssen also einen Mittelweg finden, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, aber trotzdem notwendige und vertrauenswürdige Datensicherheitsaspekte einzubauen.
Laut einer aktuellen Vodafone-Studie schrecken viele junge Deutsche vor einer Unternehmensgründung in der Digitalwirtschaft zurück. Woran liegt dies Ihrer Meinung nach?
Wir sind in Deutschland nicht gerade die Gesellschaft mit Risikobewusstsein oder Fehlerbewusstsein. Ich habe 10 Jahre in den USA gelebt – da ist es normal, dass man ein-, zweimal auf die Nase fällt – das wird bei uns schon schlecht angesehen. Bei uns ist von der Grundmentalität her diese Fehlertoleranz kaum vorhanden. Da müssen wir uns ändern!
Unsere momentan gute wirtschaftliche Entwicklung ist zudem auch nicht unbedingt Anreiz zur Selbstständigkeit. Wenn die Chancen im Job nicht toll sind, motiviert das mehr junge Menschen, auszugründen. Ich glaube auch, dass man den Gründungswillen in Deutschland durch eine umfassende Unterstützung von Anfang an verbessern könnte. Ich habe gerade ein Ausgründungszentrum evaluiert, dessen Einstellung war „Wir haben alles, wer Interesse hat, soll kommen“. So unterstützt man keine Ausgründungen! Ich habe das in den USA kennengelernt: Zweimal im Jahr wurde einen Tag lang evaluiert, was wir machen und wo Potential für Ausgründungen liegt. Die Akteure zur Ausgründung müssen aus meiner Sicht proaktiver werden und nicht nur sagen „wir können ja unterstützen, wenn jemand was braucht“ – das kann nicht der Ansatz sein.
Europa vs. Silicon Valley: Was macht Europa attraktiv für Gründer?
Ich glaube, Europa ist da attraktiv, wo es um Geschäftsmodelle an der Schnittstelle zwischen der physikalischen Welt und der digitalen Welt geht. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Regionen, die da die idealen Voraussetzungen haben: Europa und Japan. Wir haben traditionell hochwertige Ingenieurkompetenzen, die wir gut mit den digitalen Ansätzen kombinieren können.
Ich sehe zwei Herausforderungen für uns, in dem Spiel mitzuhalten: Das eine ist, das wir uns an schnellere Innovationszyklen gewöhnen müssen, als sie aus dem Engineering bekannt sind. In Zukunft werden die Innovationszyklen nicht mehr durch traditionelle Produktzyklen, sondern durch kürzere Innovationszyklen der digitalen Welt getrieben werden. Da tun sich viele traditionelle Firmen noch schwer. Und das zweite, worüber ich mir noch mehr Sorgen mache ist, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben. Der Arbeitsmarkt könnte morgen die doppelte Anzahl von Informatik-Absolventen ohne Probleme vertragen. Ein Beispiel: Airbus wollte in Hamburg vor einigen Jahren ein neues Center aufbauen und konnte dann die 2.000 IngenieurInnen nicht finden. Zum Teil, weil sie nicht da waren, zum Teil, weil sie nicht umziehen wollten. Das war eine so negative Message, dass viele Firmen sich gedacht haben, der Standort Deutschland für High-Tech ist zwar schön, aber was nutzt es mir, wenn ich kein Personal finde. Das ist übrigens nicht nur im akademischen Bereich so, wir brauchen auf allen Ebenen mehr qualifiziertes Personal. Da gibt es noch viel zu tun.
Prof. Rombach, vielen Dank für das Interview!